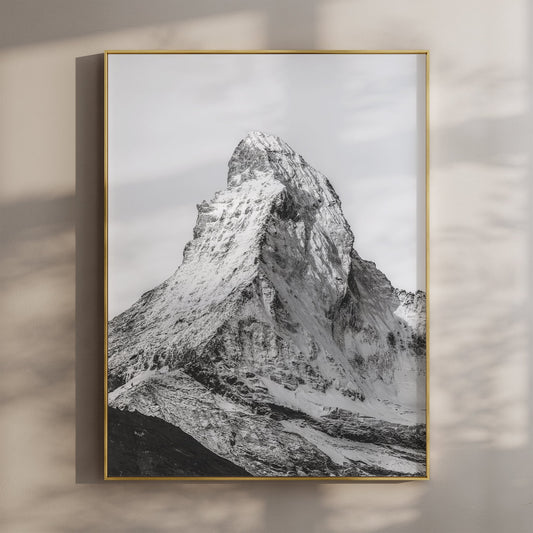Lawinenkunde: Teil 5: Wie das Wetter das Lawinenrisiko beeinflusst
Aktie
Im ersten Teil dieses siebenteiligen Kurses zur Lawinensicherheit haben wir die Lawinenarten, ihre Ursachen und die damit verbundenen Risiken vorgestellt. Im zweiten Teil haben wir die notwendige Lawinenausrüstung und deren effektive Anwendung besprochen. Der dritte Teil konzentrierte sich auf das Erkennen lawinengefährdeter Gebiete, während der vierte Teil sich intensiv mit Feldbeobachtungen und Schneedeckentests befasste, um die Stabilität in Echtzeit zu beurteilen.
Teil 4 verpasst? Hier klicken
Mit diesem Grundlagenwissen wenden wir uns nun einem der dynamischsten und einflussreichsten Faktoren für die Lawinengefahr zu: dem Wetter. Das Wetter beeinflusst nahezu jeden Aspekt der Schneedeckenentwicklung, beeinflusst ihre Stabilität und schafft oft die Bedingungen, die zu Lawinen führen.
Von Schneefall über Wind und Temperaturschwankungen bis hin zu Regen – das Verständnis der Wechselwirkung zwischen Wetter und Schneedecke ist entscheidend für die Vorhersage von Gefahren und die Planung sicherer Routen. In diesem Abschnitt untersuchen wir, wie verschiedene Wetterereignisse das Lawinenrisiko beeinflussen, und zeigen Ihnen, wie Sie dieses Wissen in Ihre Entscheidungen im Hinterland einbeziehen können.
Entdecken Sie die Schönheit des Chamonix-Tals und nehmen Sie ein Stück Alpen mit nach Hause! Unser Chamonix-Druckshop bietet eine kuratierte Auswahl atemberaubender Kunstdrucke, inspiriert von den beeindruckenden Landschaften der Region. Von dramatischen Berglandschaften bis hin zu friedlichen Alpentälern sind unsere Drucke das perfekte Souvenir oder Geschenk für jeden Bergliebhaber.
Folgen Sie uns auf Instagram unter @chamonixprints für tägliche Inspiration, Einblicke hinter die Kulissen der Alpen und exklusive Angebote. Teilen Sie Ihre Abenteuerfotos mit uns unter dem Tag #ChamonixPrints – wir freuen uns, Ihre Abenteuer in Chamonix zu sehen!

1. Starker Schneefall: Belastung der Schneedecke
Warum es wichtig ist:
Frischer Schneefall ist eine der Hauptursachen für Lawinen, da er die Schneedecke zusätzlich belastet und belastet und dadurch oft die darunterliegenden schwachen Schichten überwältigt.
Wichtige Punkte, die Sie sich merken sollten:
- Zeitpunkt: Die meisten Lawinenunfälle ereignen sich innerhalb von 24–48 Stunden nach einem Sturm . In dieser Zeit passt sich die Schneedecke der neuen Belastung an.
- Schneefallrate:
- Mehr als 30 cm (12 Zoll) Schnee innerhalb von 24 Stunden erhöhen die Lawinengefahr erheblich.
- Bei starkem Schneefall (> 2 cm/Stunde) bleibt der Schneedecke nicht genügend Zeit, sich zu verbinden, was die Instabilität erhöht.
Warnsignale im Feld:
- Schneeverwehungen: Deutet auf starke Winde während des Sturms hin, die instabile Windplatten bilden können.
- „Umgedrehte Schneedecke“: Wenn schwerer, dichter Schnee auf leichteren Schnee fällt, entsteht eine schlechte Bindung und Instabilität.
Praktisches Beispiel:
Zwei Tage nach einem Sturm mit 50 cm Schneefall fahren Sie Ski. Beim Aufstieg bemerken Sie, dass sich der Neuschnee schwer und dicht anfühlt und Ihre Stiefel in eine weiche Schicht darunter einsinken. Dies ist ein klassisches Zeichen für eine schwache Schneedecke.
Maßnahme: Bleiben Sie auf Hängen unter 30° und meiden Sie Lawinengebiete.

2. Wind: Der Schneebildhauer der Natur
Warum es wichtig ist:
Wind bewegt nicht nur Schnee – er formt die Schneedecke um und erzeugt Platten, die unter Druck brechen und verrutschen können. Auch ohne Neuschnee kann Wind vorhandenen Schnee zu gefährlichen Formationen umverteilen.
Wichtige Punkte, die Sie sich merken sollten:
- Windplatten:
- Bilden sich an Leehängen (im Wind), wo der Wind den Schnee ungleichmäßig ablagert.
- Diese Platten sind oft dicht, schwer und schlecht mit den darunter liegenden Schichten verbunden.
- Schneewechten: Starke Winde können entlang von Bergkämmen überhängende Schneemassen bilden. Diese Schneewechten sind instabil und können einstürzen und Lawinen auslösen.
Warnsignale im Feld:
- Schnee, der sich unter den Füßen hart und plattenartig anfühlt und oft ein hohles Geräusch erzeugt.
- Grate mit windzerzauster Struktur oder sichtbaren Gesimsen.
Praktisches Beispiel:
Nach einem Sturm mit 50 km/h begutachten Sie einen Steilhang. Die Leeseite ist mit frischem Windschnee beladen. Beim Graben einer Grube kommt eine dichte Platte zum Vorschein, die auf einer schwachen, facettierten Schicht liegt.
Maßnahme: Vermeiden Sie Hänge, die Anzeichen von Windlast aufweisen.

3. Temperaturschwankungen: Der lautlose Killer
Warum es wichtig ist:
Die Temperatur spielt eine entscheidende Rolle bei der Bindung oder Schwächung von Schneeschichten. Schnelle Erwärmung oder Gefrieren können die Stabilität der Schneedecke drastisch verändern.
Schnelle Erwärmung:
- Auswirkungen auf die Schneedecke:
- Schmilzt den Oberflächenschnee und fügt Wasser hinzu, das durch die Schichten sickert.
- Schwächt die Bindung zwischen Schneeschichten und verursacht häufig nasse Lawinen.
- Wenn es passiert:
- Nach einem plötzlichen Anstieg der Lufttemperatur.
- An sonnigen Tagen, wenn die Sonneneinstrahlung die Schneedecke erwärmt (insbesondere an Südhängen).
Kälteeinbrüche:
- Auswirkungen auf die Schneedecke:
- Erhält die Instabilität, indem es das Absetzen schwacher Schichten oder die Verbindung mit den darüber liegenden Schichten verhindert.
- Fördert die Bildung von Facettenschnee – einer schwachen, zuckerhaltigen Schicht, die durch starke Temperaturgradienten innerhalb der Schneedecke entsteht.
Warnsignale im Feld:
- Nasser, klebriger Schnee auf sonnigen Hängen (Hinweis auf Schmelzen).
- Harte, eisige Schichten nach einem Frost-Tau-Zyklus.
Praktisches Beispiel:
Sie fahren an einem warmen Frühlingstag einen Südhang hinab. Der Schnee fühlt sich nass und schwer an und es lösen sich auf natürliche Weise kleine Lawinen.
Maßnahme: Meiden Sie nachmittags steile, sonnenbeschienene Hänge.

4. Regen: Eine schwere Last
Warum es wichtig ist:
Regen erhöht das Lawinenrisiko drastisch, da er die Schneedecke erheblich belastet und schwache Schichten durchnässt. Regen-auf-Schnee-Ereignisse sind besonders im Hochwinter oder Frühling gefährlich.
Wichtige Punkte, die Sie sich merken sollten:
- Erhöhtes Gewicht: Regen belastet die Schneedecke enorm und führt oft zu sofortiger Instabilität.
- Schmierung: Regenwasser kann durch die Schneedecke sickern und eine rutschige Oberfläche bilden, auf der ganze Schichten rutschen können.
- Nasse Lawinen: Regen löst häufig nasse Lawinen aus, die sich langsamer bewegen, aufgrund ihrer Dichte jedoch unglaublich zerstörerisch sind.
Warnsignale im Feld:
- Wasser sammelt sich auf der Schneeoberfläche.
- Matschiger, durchnässter Schnee, der sich schwer anfühlt und durch den man sich nur schwer bewegen kann.
Praktisches Beispiel:
Nach einer verregneten Nacht bewegst du dich auf einem Hang, dessen Schnee sich wie Wasser vollgesogen anfühlt. Kleine Schneebälle rollen den Hang hinunter – ein Zeichen für Instabilität bei Nässe.
Maßnahme: Vermeiden Sie Lawinengebiete während oder nach Regen-auf-Schnee-Ereignissen vollständig.

5. Kombination von Wetterfaktoren: Das Lawinenrezept
Lawinenbedingungen sind selten das Ergebnis eines einzelnen Wetterfaktors. Es ist die Kombination von Faktoren – starker Schneefall, starker Wind, schnelle Erwärmung und Regen –, die komplexe und gefährliche Schneedecken entstehen lässt.
Beispielszenario:
- Starker Schneefall: Ein Sturm bringt innerhalb von 24 Stunden 40 cm Schnee.
- Windbelastung: Starke Winde während des Sturms lagern Schnee auf Leehängen ab und bilden instabile Platten.
- Schnelle Erwärmung: Am nächsten Tag steigen die Temperaturen stark an, wodurch die Bindungen in der Schneedecke geschwächt werden.
Ergebnis: Ein perfekter Sturm für Schneebrettlawinen. Schon das Gewicht eines Skifahrers kann einen großen Erdrutsch auslösen.
Maßnahme: Bleiben Sie in sicherem, flachem Gelände und vermeiden Sie Leehänge.
So nutzen Sie Wetterberichte zur Lawinensicherheit
Für die Planung Ihrer Tour ist es wichtig, Lawinenvorhersagen und Wetterberichte richtig interpretieren zu können.
Worauf Sie achten sollten:
- Gesamtschneefall: Wie viel Schnee ist in den letzten 24–48 Stunden gefallen?
- Windgeschwindigkeiten und -richtungen: Starke Winde und Leelagen bedeuten oft Windplatten.
- Gefrierpunkt: Hohe Gefrierpunkte deuten auf eine Erwärmung hin, die die Schneedecke destabilisieren kann.
- Regenvorhersagen: Regen erhöht das Risiko nasser Lawinen und einer Durchsättigung der Schneedecke.
Hier finden Sie Informationen:
- Nutzen Sie Ressourcen wie das Lawinenbulletin von Météo France oder lokale Vorhersagedienste in Ihrer Gegend.

Wichtigste Erkenntnis
Das Wetter ist die treibende Kraft hinter dem Lawinenrisiko. Wenn Sie verstehen, wie Schneefall, Wind, Temperaturschwankungen und Regen mit der Schneedecke interagieren, können Sie Instabilitäten besser vorhersagen und sicherere Entscheidungen treffen. Kombinieren Sie Wetterkenntnisse stets mit Feldbeobachtungen und Geländekenntnissen für einen umfassenden Ansatz zur Sicherheit im Hinterland.
Bereit für die nächste Lektion? Klicken Sie hier für Kapitel 6 – Lawinengefahrenstufen verstehen und warum „mittelschwer“ nicht sicher ist