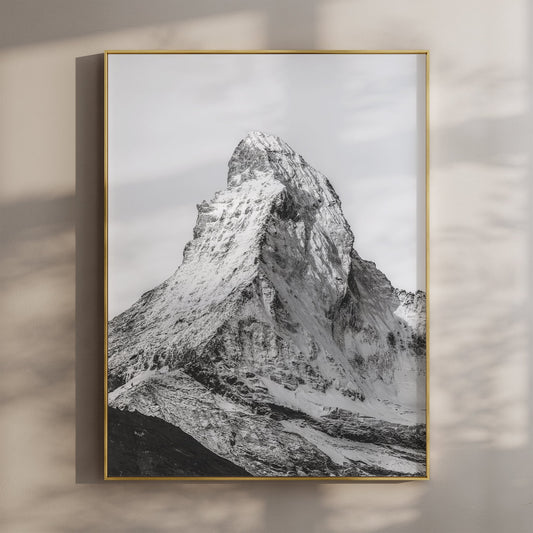Lawinenkunde: Teil 4: Feldbeobachtungen und Schneedeckentests: Beurteilung der Stabilität in Lawinengebieten
Aktie
Im ersten Teil dieses siebenteiligen Kurses zur Lawinensicherheit haben wir die grundlegenden Lawinenarten, ihre Ursachen und die damit verbundenen Risiken untersucht. Im zweiten Teil haben wir uns mit der grundlegenden Lawinenausrüstung befasst und betont, wie wichtig es ist, das richtige Werkzeug mitzuführen und damit zu üben. Der dritte Teil konzentrierte sich auf das Erkennen von Lawinengelände und lehrte Sie, Merkmale und Bedingungen zu erkennen, die das Risiko erhöhen.
Teil 3 verpasst? Hier klicken
Aufbauend auf diesem Wissen untersucht dieser vierte Abschnitt, wie die Schneedecke in Echtzeit beurteilt werden kann. Bei Lawinen geht es nicht nur um das Gelände, sondern auch um den Schnee selbst, ein dynamisches System, das sich mit den Veränderungen von Wetter, Temperatur und Wind ständig weiterentwickelt.
In lawinengefährdeten Gebieten ist die kontinuierliche Beurteilung der Schneedecke entscheidend für die Sicherheit. Zwar garantiert kein einzelner Test oder keine einzelne Beobachtung Sicherheit, doch kombinierte Techniken wie visuelle Beobachtungen, das Achten auf Warnsignale und die Durchführung von Schneedeckentests können wertvolle Erkenntnisse über die Stabilität liefern.

In diesem Abschnitt lernen Sie, die Schneedecke zu lesen, Anzeichen von Instabilität zu erkennen und effektive Tests im Gelände durchzuführen. Mit diesen Fähigkeiten können Sie Risiken besser vorhersagen und intelligentere, sicherere Entscheidungen treffen. Los geht's!
Entdecken Sie die Schönheit des Chamonix-Tals und nehmen Sie ein Stück Alpen mit nach Hause! Unser Chamonix-Druckshop bietet eine kuratierte Auswahl atemberaubender Kunstdrucke, inspiriert von den beeindruckenden Landschaften der Region. Von dramatischen Berglandschaften bis hin zu friedlichen Alpentälern sind unsere Drucke das perfekte Souvenir oder Geschenk für jeden Bergliebhaber.
Folgen Sie uns auf Instagram unter @chamonixprints für tägliche Inspiration, Einblicke hinter die Kulissen der Alpen und exklusive Angebote. Teilen Sie Ihre Abenteuerfotos mit uns unter dem Tag #ChamonixPrints – wir freuen uns, Ihre Abenteuer in Chamonix zu sehen!

Visuelle Warnsignale: Hinweise, die Sie ohne Hilfsmittel erkennen können
Bestimmte optische Zeichen können auf gefährliche Schneeverhältnisse hinweisen. Achten Sie während Ihrer Reise stets auf diese Warnsignale:
- Aktuelle Lawinenabgänge in der Nähe
- Bedeutung: Natürliche Lawinenabgänge in der Region sind ein deutlicher Hinweis auf instabile Schneeverhältnisse. Achten Sie auf frische Lawinenreste, abgebrochene Schneewechten oder Kronenbrüche (die Oberkante einer Schneebrettablösung).
- Praktischer Tipp: Gehen Sie an Hängen in der Nähe kürzlich erloschener Erdrutsche mit äußerster Vorsicht vor – sie könnten immer noch für einen weiteren Erdrutsch bereit sein.
- „Wumpf“-Geräusche
- Bedeutung: Ein „Wumpf“ ist das Geräusch einer schwachen Schicht, die unter Ihrem Gewicht zusammenbricht, ein deutliches Zeichen für Instabilität in der Schneedecke. Dies tritt häufig in Gebieten mit vergrabenen schwachen Schichten auf, wie z. B. facettiertem Schnee oder Oberflächenreif.
- Praktischer Tipp: Wenn Sie ein Wummern hören, ziehen Sie sich sofort in sicheres Gelände zurück. Dies ist einer der zuverlässigsten Indikatoren für Gefahr.
- Risse im Schnee breiten sich aus
- Was es bedeutet: Risse, die von Ihren Skiern, Stiefeln oder Ihrem Board ausgehen, weisen darauf hin, dass sich Spannungen durch die Schneedecke ausbreiten – ein Vorbote von Schneebrettlawinen.
- Praktischer Tipp: Vermeiden Sie Hänge, an denen sich Risse leicht ausbreiten. Dies ist ein deutliches Zeichen für eine instabile Bodenplatte.
- Schnee, der sich unter den Füßen schwer, nass oder „plattig“ anfühlt
- Was es bedeutet: Dichte, nasse oder plattenartige Schneeschichten neigen eher zum Abrutschen, insbesondere wenn sie schlecht mit den darunterliegenden Schichten verbunden sind. Dies ist häufig nach warmem Wetter, Regen oder Windlast der Fall.
- Praktischer Tipp: Testen Sie den Schnee, indem Sie mit Ihrer Stange oder Schaufel kleine Blöcke isolieren, um festzustellen, ob zwischen den Schichten schwache Verbindungen bestehen.

Kurze Checkliste für visuelle Warnsignale:
- Frischer Lawinenschutt.
- „Wumpf“-Geräusche.
- Ausbreitung von Rissen.
- Dichter, nasser oder plattenartiger Schnee.
Schneedeckentests: Werkzeuge für tiefere Einblicke
Visuelle Warnsignale sind zwar wichtig, Schneedeckentests liefern jedoch detailliertere Informationen zur Stabilität. Diese Tests helfen Ihnen, Schwachschichten zu identifizieren und deren Versagenswahrscheinlichkeit einzuschätzen. Für eine korrekte Durchführung ist jedoch Übung erforderlich.
1. Kompressionstest (CT)
- Zweck: Identifizierung schwacher Schichten und Beurteilung, wie leicht sie unter Druck versagen.
- So führen Sie es durch:
- Graben Sie an einem repräsentativen Hang (mit ähnlicher Ausrichtung, Höhe und Neigung wie dort, wo Sie hinreisen möchten) eine Grube.
- Isolieren Sie eine etwa 30 cm breite und 30 cm tiefe Schneesäule.
- Klopfen Sie mit zunehmender Kraft auf die Oberseite der Säule:
- 10 leichte Schläge: Verwenden Sie nur Ihr Handgelenk.
- 10 mittlere Schläge: Verwenden Sie Ihren Unterarm.
- 10 kräftige Schläge: Verwenden Sie Ihren ganzen Arm.
- Beobachten Sie, wo die Säule bricht, und beachten Sie die Tiefe der schwachen Schicht.
- Worauf Sie achten sollten:
- Plötzliche Einstürze nach leichten oder mittleren Schlägen weisen auf eine schwache und instabile Schicht hin.
- Ein fortschreitendes Versagen (Brechen nach vielen Schlägen) deutet auf eine stabilere Schneedecke hin.
Einschränkungen: Der Kompressionstest bewertet nur die lokale Stabilität. Kombinieren Sie ihn immer mit anderen Beobachtungen.
2. Erweiterter Säulentest (ECT)
- Zweck: Abschätzen, ob eine schwache Schicht einen Bruch ausbreitet, ein kritischer Faktor bei der Bildung von Schneebrettlawinen.
- So führen Sie es durch:
- Graben Sie eine breitere Grube (30 cm x 90 cm) und isolieren Sie die Säule, indem Sie die Seiten und die Rückseite abschneiden.
- Klopfbewegungen wie beim Kompressionstest durchführen.
- Achten Sie auf Risse, die sich über die gesamte Säule ausbreiten.
- Worauf Sie achten sollten:
- Brüche, die sich über die gesamte Säule erstrecken, weisen auf eine hohe Lawinengefahr hin.
- Brüche, die sich nicht ausbreiten, deuten eher auf eine örtliche Instabilität hin.
Warum das wichtig ist: Eine Schneedecke mit schwachen Schichten, die Brüche verursachen, führt eher zu großen, gefährlichen Schneebrettlawinen.
3. Handschertest
- Zweck: Ein Schnelltest zur Beurteilung schwacher Bindungen zwischen Schneeschichten.
- So führen Sie es durch:
- Graben Sie im Schnee, um einen kleinen Block freizulegen.
- Üben Sie mit der Hand Druck aus, um zu sehen, ob der Block leicht weggleitet.
- Worauf Sie achten sollten: Leichtes Scheren deutet auf eine schwache Bindung und ein höheres Lawinenrisiko hin.
Einschränkungen: Der Handschertest ist einfach, aber weniger präzise als die Kompressions- oder erweiterten Säulentests.
4. Tiefklopftest
- Zweck: Identifizierung vergrabener Schwachschichten, die tiefer als 100 cm liegen.
- So führen Sie es durch:
- Isolieren Sie eine Schneesäule, die bis zur gewünschten Tiefe reicht.
- Schlagen Sie mit dem Schaufelblatt kräftig und kontrolliert, um zu sehen, ob tiefe Schichten versagen.
- Worauf Sie achten sollten: Schwache Schichten, die tiefer als 100 cm sind, sind schwerer auszulösen, können aber bei einem Ausfall massive Lawinen auslösen.
Wann und wo Tests durchgeführt werden
Auswahl einer repräsentativen Neigung:
- Wählen Sie eine Neigung, die den Bedingungen des Geländes entspricht, in dem Sie unterwegs sein möchten:
- Gleicher Aspekt (z. B. nach Norden ausgerichtet).
- Ähnliche Höhe.
- Vergleichbarer Winkel (z. B. 30°–40°).
Auf das Timing kommt es an:
- Führen Sie Tests nach jüngsten Wetterereignissen wie starkem Schneefall, Wind oder Erwärmung durch. Diese Ereignisse sind oft die Wendepunkte für das Lawinenrisiko.
Einschränkungen der Schneedeckenprüfung
Kein Test ist absolut sicher. Die Schneeverhältnisse an einem Hang können stark variieren. Kombinieren Sie daher Ihre Testergebnisse immer mit visuellen Beobachtungen und Wetterdaten. Im Zweifelsfall gehen Sie lieber auf Nummer sicher und bleiben Sie auf sichererem Gelände.
Praktisches Beispiel: Beobachtungen und Tests kombinieren
Sie planen, nach einem Sturm, der 40 cm Neuschnee gebracht hat, einen Nordhang zu befahren. Beim Anflug bemerken Sie:
- Frische Lawinenreste auf einem nahegelegenen Hang.
- Ein „Wumpf“-Geräusch unter den Füßen.
- Risse im Schnee breiten sich aus.
Sie führen einen Druckversuch durch und beobachten nach leichten Stößen einen plötzlichen Einsturz. Dies bestätigt eine 40 cm tiefe Schwachschicht. Ein erweiterter Säulenversuch zeigt, dass sich der Bruch über die gesamte Säule ausbreitet.
Entscheidung: Dieser Hang ist zu gefährlich zum Skifahren. Sie entscheiden sich, in flacherem Gelände unter 30° zu bleiben.
Wichtigste Erkenntnis
Feldbeobachtungen und Schneedeckentests sind hilfreich bei der Beurteilung des Lawinenrisikos, bieten aber keine Garantie. Nutzen Sie sie in Kombination mit visuellen Warnsignalen, Wetterkenntnissen und Geländekenntnis. Am wichtigsten ist: Wenn Sie sich über die Bedingungen unsicher sind, wählen Sie die sicherere Route – gutes Urteilsvermögen ist im Gelände unersetzlich.
Bereit für die nächste Lektion? Klicken Sie hier für Kapitel 5 – Wie das Wetter das Lawinenrisiko beeinflusst